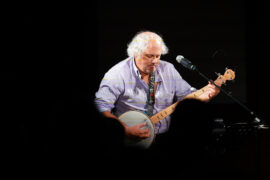Von ‚Musikexpert:innen‘ befohlen: E-Musik ist besser als U-Musik und K-Pop steht in der Hackordnung ganz unten, irgendwo hinter Schlager.
Sobald ein Genre definiert ist (wie schwammig auch immer…) wird es in Beziehungen gesetzt, in Hierarchien eingeordnet. Debatten darüber ziehen sich durch die Musikgeschichte und -wissenschaft, sind alter Schuh und Dauerbrenner zugleich. Heute also: K-Pop.
Trotz immensen globalen Erfolges wird die in Südkorea produzierte Musik in westlichen Gefilden immer noch nicht wirklich ernstgenommen. Zumindest nicht auf ästhetischer Ebene, maximal auf kommerzieller. Und dann auch nur, wenn man BTS heißt und mit Coldplay kollaboriert. Wohl vor allem aufgrund des Eindrucks von ‚Künstlichkeit‘ der Szene, die sich um perfekt inszenierte Idole, nicht um Stars oder gar geniale Künstler:innen dreht, wo Show scheinbar wichtiger ist als Musik. Derart manifestierten sich auch meine eigenen Vorurteile. Der Irritationsmoment war groß, wann immer ich über K-Pop gestolpert bin – auch und vor allem in wissenschaftlichen Kontexten. Zu überdreht. Zu mainstream. Nicht innovativ genug. Somit tieferer Beschäftigung nicht wert. Aber ganz entziehen konnte ich mich dem Phänomen dann doch nicht – und fand mich plötzlich dank hartnäckiger Algorithmen in YouTubes K-Pop-Rabit-Hole wieder.

Die schiere Masse an Content war absolut und unbedingt überwältigend, der Weg nach oben lang. Mein Mitbringsel folgende These: Eine K-Pop Gruppe kann als neue Form des Gesamtkunstwerks begriffen werden. Bevor es allen Wagnerianer:innen kalt den Rücken herunterläuft und der alte Herr selbst sich im Grabe umdreht – let me explain.
Wagner beschreibt in Das Kunstwerk der Zukunft:
„Das große Gesammtkunstwerk, das alle Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten zu Gunsten der Erreichung des Gesammtzweckes aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur.“
Dabei hatte er natürlich seine eigenen Musikdramen á la Der Ring des Nibelungen im Kopf. Gut 150 Jahre später hat sich nicht nur der Kunst- und Gattungsbegriff erweitert, sondern auch eben jene menschliche Natur verändert – und K-Pop könnte von beidem die aktuellste Manifestierung sein. Hier ist die Zeit genialer Komponisten und edgy Rockstars vorbei, es geht nicht um den einzelnen Song oder das einzelne Idol, sondern um die Gruppe und ihre vielfältig inszenierte Erzählung.
Into the Megaverse: Kunst des Konzepts
Viele der momentan erfolgreichen K-Pop Gruppen haben mehr oder weniger konkrete Konzepte, die als Grundlage für eben jenes Gesamtkunstwerk dienen – bestehend vor allem (aber nicht ausschließlich) aus Musik, Performance und Social-Media-Auftritt. Über Alben und Comebacks hinweg werden Storylines gebaut, die Konzepte vertieft oder weiterentwickelt. Dabei ist die Musik meist ein starker Genremix – in nur einem Song können Pop/Rock, Rap, Elektro, teils auch Jazz-, Latin- und folkloristische Einflüsse dicht miteinander verwoben sein. In der Regel herrscht Arbeitsteilung, Gruppen haben designierte Sänger:innen, Rapper:innen und Tänzer:innen. Erstere müssen daher nicht die anspruchsvollsten Schritte beherrschen und letztere nicht die umwerfendste Stimme besitzen, sondern in Ergänzung funktionieren und einen vollendeten Gesamteindruck hinterlassen. Und ja, auch das Aussehen zählt: K-Pop ist nicht nur auditiv, sondern extrem visuell. Denn so wie sich die Mitglieder ergänzen, so ergeben Songs und ihre Performance – Choreografie, Kostüm und Show – nur gemeinsam das gewünschte Bild. Hier in Extremform aus einer südkoreanischen kompetitiven Musikshow:
Zusätzlich kann Leben und Alltag der Gruppen 24/7 auf Social-Media-Plattformen mitverfolgt werden. Sie werden vermeintlich absolut nahbar – in ihrer ‚Freizeit‘, beim Essen und Schlafen – und machen derart für ihre Fans extreme Formen parasozialer Interaktion möglich. Das Verhältnis von Gruppe zu Fandom ist teils symbiotisch und ohne einander kaum denkbar. So wird das Kunstwerk praktisch partizipativ. Während die Gruppe die ‚Original‘-Inhalte liefert, werden diese vom Fandom in Edits und Compilations verarbeitet, dadurch Konzepte und Geschichten erweitert. TikTok-Challenges, sowie Fan-Chants und Lightstick-Choreografien bei Live-Konzerten laden verstärkt zum Mitmachen ein. Damit ist K-Pop immer ein Kunstwerk vieler für viele und kann daher kaum etwas anderes als Mainstream sein. Er gewinnt aber durch die Anzahl von Mitwirkenden und Erzählebenen an Komplexität und ist doch in einem Aspekt ein bisschen wie Oper. Je mehr man weiß, desto mehr Insider versteht und desto mehr Spaß hat man. In Übersetzung für Wagnerianer:innen: Man entdeckt immer mehr Leitmotive.
Fern von “Alles in Butter“
Leicht verliert man allerdings zwischen schnellen Kameraschnitten und blendenden Lightshows aus dem Blick, dass K-Pop zwar verstärkt für ein globales Publikum produziert wird, seine Wurzeln aber in einer Gesellschaft hat, die trotz rasanten Wandels von Traditionen und Überzeugungen durchdrungen ist. Die Heimat des K-Pop ist nicht mit progressiven westlichen Werten vereinbar. Feminismus- und Anti-Rassismus-Debatten stecken noch in den Kinderschuhen, Geschlechtergerechtigkeit und LGBTQ+-Rechte sind Mangelware, extrem hoher gesellschaftlicher (Leistungs-)Druck äußert sich in astronomischen Suizidraten. Wo auch nur ansatzweise feministische Äußerungen und queere Coming Outs zu heftigen negativen Reaktionen führen, tanzen viele Idole auf Eierschalen und leisten zudem der staatlichen Erwartungshaltung Folge, politische Neutralität zu wahren. Wer sich einen Platz in der stark umkämpften Industrie erarbeiten konnte, will diesen durch nichts gefährden. Damit gibt sich K-Pop unpolitisch und deckt eine nicht mehr zeitgemäße Gesellschaft. Wandel wird hier momentan fast nur von internationalen Teilen der Fandoms mit anderen Wertesystemen angestoßen. Wie alle Idole nur zu gut wissen: Fans haben Macht. Vernetzung und Einfluss sind immens, im positiven wie negativen Sinne.
Ein Wonderland für sich
Mittlerweile füttere ich den Algorithmus, habe ein Lieblings-Gesamtkunstwerk fern von Wagner und eine lange Playlist mit dem Titel ‚Rabit Hole K-Pop‘ – aus diesem Loch bin ich nämlich bisher nie wirklich wieder herausgekommen, habe nur die kulturanalytische Brille aufgesetzt. Die nehme ich schließlich überall mit hin. Der Blick dadurch spannend: K-Pop bietet Gemeinschaft im Digitalen, scheinbar basisdemokratische Kunst und Eskapismus durch parasoziale Interaktion und ist damit Abbild und Bedürfniserfüllung der ‚neuen‘ menschlichen Natur. Ob in „Vollendung” ist diskutabel, erklärt aber die stetig wachsende Popularität. In seiner aktuellen Form ist das Genre mit all seinen Paradoxa auf Gen Z zugeschnitten und gewinnt für diese weltweit an Bedeutung und Einfluss. Ästhetische Schwerpunkte und Konzepte entwickeln eigene Dynamiken, die es so in westlicher Pop-Musik nicht gibt. Das ist (noch) nicht bei alteingesessenen ‚Musikexpert:innen‘ und Radiosendern angekommen, dominiert aber viele Ecken des Internets. Damit wird es zunehmend problematisch, K-Pop nicht ernst zu nehmen, insbesondere in kulturwissenschaftlichen Kontexten, in denen wir nicht zuletzt versuchen Gesellschaft besser zu verstehen. Dieser Fehler ist der Musikwissenschaft schließlich beim Aufkommen von Rock- und Popmusik schon einmal unterlaufen und hängt ihr immer noch nach – auch wegen eines lange bestehenden Mangels an passenden Analysekategorien für die neuen Genres. Das Framing von K-Pop als Gesamtkunstwerk kann daher nur als erstes Hilfsmittel dienen. Perspektivisch müssen auch hier spezifische Parameter und eigene Schablonen entwickelt werden. Ernst nehmen heißt außerdem nicht gleich gut finden, sondern ist Ausdruck einer grundsätzlichen Offenheit, mit der wir idealerweise allen Genres begegnen sollten. Dann können wir immer noch entscheiden: How you like that?