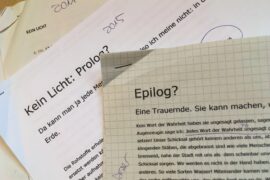Die experimentelle Musiktheaterproduktion „Homo Instrumentalis“ beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung: Wo kommt sie her, was zeichnet sie aus, und wo bringt sie den Menschen noch hin? Das Ensemble des Produktionscenters „Silbersee“ begegnet diesen Fragen in seiner Auslegung dabei vor allem dystopisch.

Foto: Caroline Seidel/ Ruhrtriennale
Durchdringende Bässe, die bis in den Rücken gehen, sich androgyn-schlangenhaft auf der Bühne bewegende Tänzer, Sprache, Französisch meist, tourettehaft zerstückelt und wie rückwärts gesprochen, wie verschluckt oder eingeatmet: Vieles an „Homo instrumentalis“ ist entweder faszinierend oder unheimlich oder beides auf einmal. Angenehm zu schauen ist es jedenfalls nicht. Wäre es das, wäre aber wohl die Zielsetzung des Musiktheaterprojekts verfehlt: Es geht in vier Teilen darum, wie sich der Mensch seiner eigenen Erfindung, der Technik, zum Sklaven macht, und wie er letztendlich sogar von ihr überwunden wird.
„Der schaffende Mensch“ heißt das erste Kapitel, in dem noch scholahaft-klassisch anmutender eisklarer vierstimmiger Frauengesang den Großteil der Musik ausmacht, wenn Fanny Alofs (Alt), Jennifer Claire van der Hart (Sopran), Eléonore Lemaire (Sopran) und Michaela Riener (Mezzosopran) in bodenlangen Gewändern am Bühnenrand stehen und ihre Stimmen, a Cappella, in diesen Raum schicken, in dem, man ahnt es schon, sie in den nächsten eineinhalb Stunden aufgenommen, verfremdet, elektronisch bearbeitet wieder abgespielt, nicht wiedererkennbar, zu hören sein werden. Nur ganz zart im Hintergrund kündigt sich schon der künstliche Sound an, der die Menschen in diesem Stück mehr und mehr übertönen, ihnen das Singen, ihre Sprache abnehmen wird.
Fenster in eine andere Welt

Foto: Caroline Seidel/ Ruhrtriennale
Schleichend geht dieser Prozess vonstatten, und damit genauso bedrohlich erdrückend. „Silbersee“ erschaffen eindrückliche Bilder in ihrem Bühnenbild, das eigentlich nur aus einer Art doppelt verglasten Fensterfront besteht, die man mit Nebel füllen und als Projektionsfläche nutzen kann, als eine Art Fenster in eine andere Welt, als Bildschirm, Dach, überdimensionales Reagenzglas, als Schattenwand. So sitzt Sopran-Solistin Eléonore Lemaire im zweiten Teil „Der industrielle Mensch“, singend beschreibend und kommentierend, weit über der leicht nach vorn geneigten Schattenwand, um die gebeugte Kreaturen langsam und sinnlos im Kreis herumgehen – wie Rodins „Denker“ über dem Höllentor. Nur besteht Dantes Inferno an dieser Stelle nicht im Jen-, sondern im Diesseits. Es ist eine vom Menschen selbst geschaffene Hölle, in der die ausgebeuteten Stahlarbeiter „extremster Hitze“, „geschmolzenem Stahl“ und „giftigen Gasen“ ausgesetzt sind, wie es in leider google-translate-schlecht übersetzten Sätzen auf den Außenflügeln dieses Bühnen-Tryptichons projiziert steht. Immerhin singt noch ein Mensch auf der Bühne! Mehr und mehr wird nämlich auch die Stimme, die Sprache zu etwas, das mehr dem Verhalten und Klingen eines Computers als dem eines Menschen gleicht – was eine bemerkenswerte technische Leistung der Sängerinnen ist.
Beim Zuhören wird dabei das Atmen schwer, bleibt einem irgendwie auch die Luft weg, wenn es wirkt, als würden die Figuren auf der Bühne an dem, was sie sagen, an ihrer Sprache, würgend ersticken. Was sie vorher von sich gegeben haben, war aber auch mehr Programmier- als „echte“ Sprache: „A implique B, B implique C, C implique D, D implique X“ und wieder von vorne. „Je m’implique, je ne m’implique pas, j m’implique …“ In diesem Teil „Der Cybermensch“ ist der Mensch auf der Bühne nicht nur „cyber“, er hat genauer gesagt keine Möglichkeit mehr, selbstbestimmt zu handeln. „Finis! Finis!“, ruft es zuckend in irgendeine Richtung, wenn beim Sprechen wieder unkontrollierte Laute, Schluck- und Krächzgeräusche aufgestoßen sind, es hat etwas von Tourette: Da ist etwas in mir drin, über das ich keine Kontrolle mehr habe und das droht, mich mehr und mehr zu steuern. Gesungen wie zu Beginn wurde schon lange nicht mehr.
Keine Menschen mehr
So funktioniert „Homo instrumentalis“ wie ein fatalistischer Sog, grotesk und skurril und verstörend und manchmal auch lustig, wenn man glaubt, aus Georges Asperghis‘ „Machinations“-Fantasiesprache in der szenisch überzeichneten „Silbersee“-Version Absichten und Interaktionen zu verstehen. Der dramaturgische Aufbau des Stücks ist vor dem Hintergrund der Ausgangsfrage logisch und zwingend: Will der Mensch den Tod überwinden, muss er sich womöglich selbst überwinden und etwas schaffen, das den Tod in seinem Namen überlebt. So gibt es in „Jenseits des Menschen?“ keine Menschen mehr auf der Bühne. Dafür Nebel, der das Publikum einhüllt, und die in der Luft hängende riesige Fensterfront, hinter der Stahlgerüste der Duisburger Gebläsehalle sichtbar sind. Menschenleer. Pure Technik. Und dazu Bass, der in den Rücken geht.