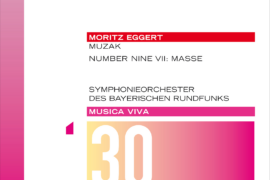Im Gespräch mit Michael Stegemann
von Lea Nitsch und Maike Graf
9, eine Zahl zwischen 8 und 10. Ungerade. Die höchste einstellige Zahl in unserem Dezimalsystem. Außerdem die Anzahl der wichtigsten musikalischen Werke unserer Zeit. Werke, mit denen die europäische Musikgeschichte zu stehen und fallen scheint. In diesem Jahr werden wir in der Klassikwelt lernen, dass Beethoven neun unglaubliche Sinfonien, 32 wundervollste Klaviersonaten und sowieso nur Großartiges komponiert hat. Schönste Musik, die man nicht genug hören kann und bitte auch überall, über-oft hören soll. Zumindest könnte man meinen, dass uns das die Konzerthäuser dieses Jahr erzählen wollen. Denn man feiert ja schließlich, seit dem 17. Dezember 2019, 250 Jahre Ludwig van Beethoven, und er ist überall.

Als wahnsinniggroßes Musikgenie ist Beethoven schon lange hoch erhoben und auch außerhalb der Klassikbubble nicht mehr zu übersehen. Besonders durch den Kulturetat 2020: Bonn und Wien eskalieren mit Beethovenstatuen und beethoven’schen Veranstaltungen aller Art, die Konzerthaus-Spielpläne lesen sich wie Beethoven à la carte und es ist auf einmal verwerflich nicht sofort das Hauptmotiv mitsummen zu können, wenn jemand die Eroica erwähnt.
„Aus unserer 200 Jahre späteren Perspektive nehmen wir die Sache ziemlich verzerrt wahr.“
So schätzt Michael Stegemann, Leiter des Instituts für Musik und Musikwissenschaft an der TU Dortmund, den Status Beethovens ein. Denn, ob er wirklich so eine Größe gewesen ist oder wir ihn zu einem Giganten gemacht haben, lässt sich heute kaum noch sagen.
Da trillert die Frage herein, was eigentlich gewesen wäre, wenn es den immensen Beethoven nicht gegeben hätte. Wenn dem kleinen Ludwig eines sonnigen Tages ein besonders schwerer Blumentopf auf dem Kopf zerschellt wäre und er somit die Tasten abgegeben hätte? Wie sähe die Welt heute aus, wenn er sich nach seinem Heiligenstädter Testament 1802 tatsächlich das Leben genommen hätte, wie er es für möglich erachtete, wenn es die Musik nicht gäbe? Oder wie wäre die Musikgeschichte verlaufen, wenn Beethoven Haydn nie getroffen hätte; ihm nie nach Wien gefolgt wäre, um Unterricht zu nehmen? Eines ist sicher, seine Komponisten-Büste würde bestimmt auf keinem Klavier stehen.
Big City B…
„Wie kann man neben Beethoven als Komponist in Wien existieren?“ So kritzelte es Franz Schubert in sein Tagebuch. Er selbst lebt als Zeitgenosse in Beethovens Wien. Wirklich musikalisch existiert er nicht – seine Werke werden nicht aufgeführt. Dass Beethoven in der musikalischen Welt auftaucht, entlockt ihm die Big City Wien. Michael Stegemann ist sich sicher: „Wäre Beethoven nicht nach Wien gegangen, dann hätte sich sein kompositorischer Geist wahrscheinlich nie auf solch durchschlagende Weise entwickelt.“ Denn Bonn hat damit überhaupt nichts zu tun.
„Das, was er mit 22 Jahren als Komponist vorzuweisen hat, ist nicht der Rede wert. Das ist durchschnittlich und auch talentiert, aber da ist nicht mal ansatzweise irgendetwas von dem Genie zu ahnen, das er in Wien entwickeln wird“ – und welches wir heute in Beethoven sehen wollen.
Der Big Bang für den jungen nicht-groß-Komponisten passiert also in Wien, maßgeblich durch sein musikalisches Umfeld (Haydn, Albrechtsberger, Salieri) und die finanziellen Förderungen, die auf den Big-City-Beethoven herabregnet. Nur dadurch konnte der Komponist, der das Traditionelle gerne in Frage stellte, seine modernen Ideen öffentlich präsentieren. Beethoven in Bonn ist quasi äquivalent mit der Vorstellung der Nichtexistenz Beethovens.
„Wie kann man neben Beethoven als Komponist existieren?“ – sehr gut, denn ohne die Wiener Entwicklungen wäre Beethoven nie zu solch einer kompositorischen Größe erwachsen.
Im Gedankenexperiment mit Michael Stegemann radieren wir Beethoven in Wien aus. Was bleibt, ist der Platz für ein Genie. Für irgendein Genie. Dass gerade Beethoven unter den Geldregen und in die Applausströme geriet, war keine Notwendigkeit. Hätte es Beethoven nicht gegeben, wäre vielleicht ein Komponist, der einst im Schatten Beethovens verkümmerte, zu solch einem Riesen geworden.
„Auf alle Fälle war der Zeitgeist, in den Beethoven mit seiner Musik eingreift, so, dass es zwingend eine Veränderung gegeben hätte“, erklärt Musikwissenschaftler Stegemann.
„Die Zeit war reif für eine Veränderung, und Beethoven war gerade da und hat sie durchgeführt.“
„I want to break free“
Im Jahre 1800 vollendete Beethoven seine erste Sinfonie, op. 21. „Was er in die Musik einbringt, ist eine Revolution der Instrumentalmusik. Er schafft es sie zu etablieren, indem er sie auf eine vollkommen einzigartige und neue und originelle Weise in Frage stellt.“ He wanted to break free. Wer sich in der Tradition der großen Drei der Wiener Klassik – Haydn, Mozart, Beethoven – sieht, stand nach den großen neun Sinfonien an einer Art „point of no return“, wie Stegemann ihn nennt. Das beethoven’sche Hochwasser löste in manch einem Zeitgenossen, wie Franz Schubert oder Johannes Brahms, die ein oder andere Schaffenskrise aus. War es nach Beethovens Freiheitsschlag zwar möglich eine Sonate aus nur zwei Sätzen zu schreiben, forderte der Big Bang Beethoven aber auch, immer mit einbezogen zu werden.
So ist es in der Instrumentalmusik; wer aber in der Zeit um 1820 Erfolg haben wollte, tut das eigentlich „in erster Linie mit der Oper“, beteuert Michael Stegemann. Eine Gattung, die nicht von dem Big Bang Beethoven erschüttert wurde. Seine einzige Oper „Fidelio“ gleicht in ihrem Einfluss eher einem seichten Erdbeben als der Kollision zweier Planeten. Die Oper bleibt beethovenfrei, die Instrumentalmusik ist von ihm überflutet.

Nun gibt es auch Komponisten, die sich von dem zwanghaften Bezug zu Beethoven befreien konnten. Hector Berlioz, Robert Schumann, Frédéric Chopin, sie alle kannten Beethoven und haben es doch geschafft, sich einen eigenen Namen zu machen und etwas komplett Eigenes zu schaffen. „Natürlich hat Berlioz seinen Beethoven gekannt und seine Musik bewundert. Aber er interessiert sich nicht dafür, weil er sich nicht in dieser Tradition sieht“, sagt Michael Stegemann. Die 1830 von Berlioz komponierte Symphonie fantastique op. 14 stelle auf ihre Weise Beethovens Revolution wiederholt in Frage und finde eine ganz eigene Antwort. Auch der für die Romantik so essentielle Frédéric Chopin komme ohne Beethoven aus. Ebenso die Liedkompositionen von Robert Schumann.
„In dem Moment, wo ich mich innerhalb einer mitteleuropäischen Tradition mit Beethoven beschäftige, muss ich mich dazu verhalten. In dem Moment, wo ich sage, diese Tradition ist nicht meine, kann ich auch etwas völlig anderes tun.“
Optimize yourself
Selbstoptimierung und Selbstinszenierung ist nicht erst im Zeitalter der perfekten Instagramwelt ein Problem. Auch Beethovens Sekretär Anton Schindler wusste um die Möglichkeiten, die eine kleine Brise fake-Dramatik bieten könnte; #fürmehrrealitätinbeethovensleben. Natürlich wurde Beethoven als großer Komponist gefeiert, aber neben den Pressestimmen über den „Meister Beethoven“ gibt es auch Momente, in denen eine Sinfonie von Anton Eberl mehr interessiert als Beethovens Eroica – und das bei deren Uraufführung! Oder welche, in denen Beethovens späte Streichquartette als musikalisches Chinesisch unverstanden bleiben.
Der Mythos Beethoven, der aus durchgestrichenen Napoleon-Widmungen und beethoven’schem Weltschmerz erbaut wurde, ist bewusst gesät worden und überwuchert heute das Bild, das wir von dem vermeintlichen Titanen haben. Es ist geglättet und hübsch gephotoshopt. „Vieles davon ist unglaubwürdige Legende“, meint Michael Stegemann.

Die Legenden und Klischees machen auch die Musik größer als sie ist, denn an mancher Stelle ist sie es nicht selbst. Der berühmte Traumermarsch der Eroica findet sich schon ansatzweise in Beethovens Klaviersonate op. 26 und geht wiederum zurück auf einen Trauermarsch von François-Joseph Gossec, erklärt Stegemann: „Also so gesehen ist das Alles nicht besonders dramatisch.“ Da hilft nur ein dramatischer Instagram-Filter.
Dam dam dam daaaaaaam.
Lauteres fortissimo, extremere Kontraste auf minimalstem Abstand und stärkster Pathos. Wer heute Beethoven interpretiert, scheppert auch gerne mal den ganzen Konzertsaal weg – aua. Die titanische Größe, für die wir Beethovens Musik kennen und lieben, wurde durch die Rezeptionsgeschichte stark verstärkt; wie bei einer Runde „Stille Post“, bei welcher der Letzte nach 250 Jahren nur noch laut schreit, anstatt präzise zu artikulieren. Die heutigen Interpretationen triefen von dem „Klischee des Pathos, der Überhöhung, der Erhabenheit“, meint Stegemann. (Gar nicht nur im Hinblick auf nazi-ästhetische Affinitäten, sondern schon bei den Karajan-Interpretationen der 1950er Jahre). Da ist gar nicht so wichtig, wie viel von dieser goldenen Pracht tatsächlich in der Komposition steckt; ein „schlanker, straffer Klang“ wäre wahrscheinlich viel eher historisch informiert. Nun sind die Musiker aber immer mehr versucht in die Klischeekiste zu greifen, die „Person noch ein bisschen mehr mit einem Heiligenschein zu umgeben“ und die Musik Beethovens nach Big B klingen zu lassen.
A Star is made …
Ist Beethoven ein kreierter Star? Die Verzerrung der Wirklichkeit lässt uns heute nur einen Teil dessen sehen, wie es wirklich damals gewesen sein kann. Die Figur des tragischen Helden, der durch seinen Hörverlust die einzige Konstante in seinem Leben verliert, ist das, was für uns heute zurückbleibt; wie die Gesellschaft ihn sehen will oder vielleicht auch er gesehen werden wollte (#relatableshit). Beethovens Projektionsfläche wird auch dieses Jahr bestehen bleiben, mitunter sogar größer werden. Was dagegen hilft ist ein wohl dosierter „realitycheck“ und das Bewusstsein dafür, dass auch Beethoven ein Kind seiner Umstände ist. Die Zeit war reif für Veränderungen und Beethoven zur Stelle, um diese in der Instrumentalmusik umzusetzen. „Ich weiß nicht wer – und vielleicht auch nicht unbedingt in Wien. Vielleicht hätte der Weg gar nicht über die Sinfonie geführt, sondern eher über Streichquartette (also schon in früheren Jahren)“, sagt Michael Stegemann. Es hätte Frédéric Chopin sein können, „der mit seinem Klavierstil in den 1820er und 30er Jahren eine neue Welt erschließt.“
„Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte ohne Beethoven, aber es hätte spannende Alternativen gegeben“, da ist sich Stegemann sicher. Ganz ohne ihn gewollt hätte er aber auch nicht.

Univ.-Prof. Dr. Michael Stegemann hat ein gespaltenes Verhältnis zu Beethoven.
Als Lehrstuhlinhaber für historische Musikwissenschaft erklärt er in sprudelnden Sechzehntelläufen und mit sprunghaften Tonartwechseln der Themen seinen Studierenden die facettenreiche Musikwelt. In diesem und den nächsten Semester steht auch Beethoven auf seinem Seminarplan. So muss das ja sein im Beethovenjahr.
Michael Stegemann sieht das Beethovenjahr 2020 als Teil des Problems, des Über-Geniekults um Beethoven. Der ohnehin schon beeinflusste Status des Titanen wird dadurch nur noch mehr überhöht. Eine Ehrung, die gerade Beethoven nicht braucht. Vergessen werden wir ihn bestimmt nicht.
Hintergrundbild und Beitragsbild: Pixabay
GIFs: Giphy