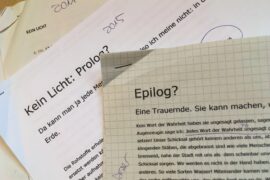Julian Prégardien und Lars Vogt haben im Dortmunder Konzerthaus Franz Schuberts Liederzyklus “Die Winterreise” interpretiert. Unsere Autorinnen sind gespaltener Meinung.

Es knackt und klirrt im Klavier
Von Sophie Emilie Beha
Zwei Herren in Schwarz
Von Ida Hermes
Die „Winterreise“ ist ein Berg. Ein schneebedeckter Gipfel im Romantikgebirge. Schon viele haben sich an diesem Liederzyklus von Franz Schubert versucht. Nicht nur Sänger und Pianisten, auch erstaunlich viele Komponisten-, Dichter- und Malerkollegen haben sich in den Bann ziehen lassen von der Geschichte des einsamen Wanderers, von dem man nicht weiß, ob er in den Tod geht. Die Bergsteiger am vergangenen Abend im Dortmunder Konzerthaus heißen Julian Prégardien und Lars Vogt.
Schon in den ersten Takten des Klaviervorspiels spürt man sie, die Fremde. Vogt überpointiert, er befrachtet die mit einem Akzent oder Fortepianozeichen versehenen Achtelnoten mit Rubatotrauerflor. Prégardien singt mit warmem Timbre vom Abschiednehmen und von verlorener Liebe. Je süßer es klingt, um so schwerer wiegt der Verlust, der Wanderer ist rastlos, zerrissen zwischen den sterbenden Träumen und der ernüchternd-kalten Welt ringsum. Zu den Worten „dass man mich trieb hinaus“ lässt Prégardien seine Stimme anschwellen, beim Pianissimo sinkt sie zurück ins Nichts. Stille, aus der Vogts harte Akkorde herausreißen. Töne erklingen und erstarren zugleich.
Das fünfte Lied, der liebe „Lindenbaum“, ist dagegen die pure Verheißung. Endlich wieder Dur! Die Achtelnoten im Klaviervorspiel verschwimmen, aus ihnen strömt Seligkeit wie Dampf aus einer Teetasse. Aber sie kühlt ab, von Mollakkorden übermannt, und Prégardiens Stimme wird dunkler, verliert ihren Glanz. Glück ist in der „Winterreise“ nur eine flüchtige Illusion.
Prégardien und Vogt legen den Fokus ihrer Interpretation auf die verschiedensten Seelenzustände. Dabei gelangt Prégardien stimmlich einerseits an seine Grenzen, und er sucht sie auch, andererseits. Krasse Registerwechsel, allzu scharfe Konsonanten, aber ein beinahe durchsichtiges Pianissimo. Im Klavier klirrt und knackt es, Vogt lässt lautmalerisch die „Hähne krähen“ und das „Eis zerspringen“. Diese Lesart der „Winterreise“ lebt von ihren Möglichkeiten und überrascht durch ihre Vielschichtigkeit. Sie ist nicht trostlos-tonlos, ihre Kälte vibriert.
Bis zur völligen Erstarrung sind es viele Stationen. „Auf dem Flusse“ stottern die Achtelnoten. Nach „Einsamkeit“ verharren Prégardien und Vogt in Stille, senken die Köpfe, Prégardien dreht sich dem Flügel zu. Verschnaufpause? Aufgeben? Nein. Suggeriert im zweiten Teil des Zyklus „Die Post“ anfänglich noch Optimismus, so wird es im Folgenden noch dunkler, abstruser, surreal. In „Die Krähe“ reicht ein Intervallsprung, um den Freund zum Feind werden zu lassen. Die Wanderung, an sich ohne Ziel, führt in den Wahnsinn.
Das „Irrlicht“ erscheint erstrebenswerter als das „helle, warme Haus“, der Wanderer erkennt nun: „Nur Täuschung ist für mich Gewinn“. Wo nichts ist, kann auch nichts mehr kommen, und der Wanderer resigniert, schon bevor er das „Wirtshaus“ erreicht. Mit der letzten leeren „Leiermann“-Quinte ist die „Winterreise“ zu Ende. Prégardien und Vogt fallen in eine lange, erlösende Umarmung. Applaus.
Fahlgrau schimmert die Stimme. Während er die letzten Verse singt, wirkt Julian Prégardien ganz in sich gekehrt. Er senkt den Kopf. Der Pianist Lars Vogt haucht noch eine Achtelkette dahin. Seltsamerweise werden im „Leiermann“ aus Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ alle immer langsamer, auch diese beiden. Gebannte Aufmerksamkeit im Konzerthaus Dortmund. Alle Blicke haften an den beiden Herren in Schwarz, die sich lange umarmen.
Die „Winterreise“, nach Gedichten von Wilhelm Müller, erzählt von einem einsamen jungen Mann auf Wanderschaft, der seine Liebe verloren hat. Was immer ihm auf seinem Weg begegnet, es spiegeln sich für ihn darin Erinnerungen, Träume und Illusionen, in Konfrontation mit der eisigen Wirklichkeit. Prégardien führt seine Stimme denkbar klar, beinahe vibratolos, penibel in den Details, Ausdruck und Valeurs von Wort und Ton abwägend. Gerade die leisen Stellen sind seine Stärke, das weiche Legato und leuchtende Pastelltöne, in Liedern wie „Die Nebensonnen“ und „Frühlingstraum“. Vogt begleitet mit einem bis zur Unhörbarkeit feinen Anschlag, um leider immer wieder furios dazwischen zu fahren. Und er lebt die in den Klaviersatz hineinkomponierten Tonmalereien voll aus: Er bellt, kräht, leiert und steigt dabei oft allzu hart in die Eisen.
Auch Julian Prégardien meint es manchmal ein wenig zu gut, zum Beispiel in „Wasserflut“: Die Moll-Triolen zu den Worten „Manche Thrän’…“ beginnt er mit feinem Strich und spitzen Punktierungen, gerät beim „heißen Weh“ dann völlig in Rage. Lange Notenwerte werden geradeaus gesungen, starr und stur, und verlängert durch Fermaten. Gelegentlich führt die Überinterpretation sogar zu Problemen beim Registerwechsel. Das Lied vom „Leiermann“ verliert sich, wie gesagt, in Rubato-Längen. Das bringt eine Dynamik hinein, die in den Noten jedenfalls nicht steht. Der Puls der Komposition, auf dem Bordunton der Drehleier beruhend, ist eigentlich eher gleichmässig, monoton. Warum diese Verlangsamung am Ende, beinahe bis zum Stillstand? Ist es so sicher, dass dem Wanderer im Leiermann der Tod begegnet?
Fotos-Credits Julian Prégardien:
© Marco Borggreve