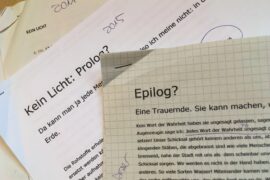Irgendwie mutet das komisch an: Am Sonntag der Bundestagswahl, kurz nachdem bekannt wurde, dass die rechtspopulistische AfD als drittstärkste Partei in den Bundestag einziehen wird, inmitten all der dadurch aufkommenden unheimlichen Assoziationen und historischen Erinnerungen, findet bei der RuhrTriennale die Premiere des wohl unpolitischsten Theaterstücks des Festivals statt. „Kleine Seelen“ (Regie: Ivo van Hove) versprach, ein sowohl tiefsinniges wie auch anregendes Psychogramm des modernen Menschen zu werden – doch es wirkte an diesem Tag an diesem Ort nur kitschig und gehörig fehl am Platz.

Foto: Jan Versweyveld/ Ruhr Triennale
Da liegt ein großer Perserteppich auf dem Bühnenboden, stehen gesunde und halbgesunde Pflanzen aller Größe und Coleur am Bühnenrand, hinter ihnen langgezogene Balkone mit kleinen Bänken. Die Protagonisten bewegen sich von dieser Bühne nicht herunter, sitzen, stehen, hängen verstreut auf Stühlen, kleinen Tischchen und Geländern, vor allem liegen sie viel auf dem Boden, räkeln sich, rollen herum. Ihnen ist langweilig, und ihnen geht es schlecht. Aber nicht, weil die Welt um sie herum schlecht wäre, weil sie Ambitionen hätten, diese zu ändern und damit scheitern. Nein, es geht ihnen schlecht, weil es ihnen so gut geht.
Da ist Protagonistin Constance (Chris Nietvelt), 51 Jahre alt, die vielleicht vielen 51-Jährigen aus der Seele spricht, wenn sie sagt: „Es ist ein befremdliches Gefühl. Alt werden ohne gelebt zu haben.“ Da ist die jüngere Marietje (Hélène Devos), die seit dem Tod ihres Vaters verstört ist: „Zwischen mir und dem Tod ist fast nichts.“, und ihre Schwester Gerdy (Noortje Herlaar), die jung und ungestüm und lebenslustig sein soll, aber eigentlich genauso abhängig ist von dieser schlecht gelaunten Familie wie alle anderen. In der Mitte steht Addy (Robert de Hoog), Sohn von Constance und ihrem Mann van der Welcke (Steven Van Watermeulen), der von allen Seiten beansprucht wird, von allen aber der am meisten Gelangweilte zu sein scheint.
Bestehende und neue Probleme
So trottet die Erzählung dahin, alle sind unzufrieden und resigniert, sie träumen ihr Leben und leben nicht ihren Traum, wie es so schön nichtssagend als Kalenderspruch heißt. Sie sitzen fest in ihrer selbstgebastelten Hölle, diesem Haus auf dem Land, durch das es zieht und in dem es schon zu spuken scheint. Sie hocken aufeinander und tun sich nicht gut.
Nun will „Kleine Seelen“ aber erzählen, wie diese Menschen versuchen, aus ihrer Situation auszubrechen. Zwei Stunden lang kommt jede Figur ein- oder mehrere Male zu Wort, werden bestehende Probleme („Du liebst mich nicht!“) angesprochen und neue gemacht: „Ich bin zu alt“, sagt Brauws (Hans Kesting), Constances Liebhaber. „Meine Liebe wäre immer nur der Gedanke an das, was wir verpasst haben.“ Es kommt so emanzipiert daher, wenn Constance ihrem Mann endlich das Angebot macht, sich zu trennen – aber „in Liebe“, und dann liegen sie sich lange schluchzend in den Armen –, oder wenn Addys Frau Mathilde (Maria Kaakman) ihn seiner „Familie zurück“ gibt, weil sie sein „Opfer“ nicht annehmen will, mit ihr in die Stadt zu ziehen. Alle sind so vernünftig und so stark. Es wird aus Rührung ganz viel geweint auf der Bühne, da ist eine Menge jahrelang unterdrückter Schmerz, der in gerade diesen zwei Stunden wie aus einer angequetschten Zahnpastatube herausquillt.
Ironie würde helfen
Manches bräuchte nur ein kleines bisschen mehr, und es würde schon wieder in gesundmachende Ironie umschlagen: Beispielsweise Constances Ausruf „endlich zu lieben“ und „endlich zu leben“, während sie die Arme in die Luft wirft und ein unsichtbares Gebläse hinter ihr ihr Kleid und ihre Haare flattern lässt. Leider gelingt dem niederländischen Ensemble dieser Bruch zu oft nicht, der das ganze Gefühlsgewaber erträglich machen würde. Stattdessen hat klassischerweise die Oma (Frieda Pittoors), die sich mit weisem, leisem Lächeln immer irgendwo zwischen den Pflanzen aufhält, das letzte Wort. „Gibt es denn nichts, was der Lüge entgeht?“, fragt sie, ganz allein auf dem Perserteppich. „Es gibt das Schöne nicht mehr. Doch, außer in einem Kind, da sieht man es manchmal. Und in der Musik. Sie ist nur Klang, reiner Klang, Freiheit.“
Diese ganzen Weisheiten kommen nicht gerade sporadisch, und so entwickeln sie etwas Abgeschmacktes, als würde man gleich drei geschenkte Jahres-Wandkalender mit Blumenfotos und Sprüchen durchblättern und bei jedem gelesenen Satz bedeutungsvoll nicken.
Das Schlimme ist: Die Schauspieler machen ihren Job auf der Bühne wirklich gut. Es ist ganz starkes Emotionstheater, was die Besucher bei der Premiere zu sehen bekommen. Das Bühnenbild ist inspiriert und interessant, und Harry de Wit, der mit Flügel, Klarinette, Windmaschine und Hammond-Orgel auf der Bühne sitzt und die permanent klimpernde jazzig-poppige Musik live spielt, kann gut, was er da macht. Es gibt nur alles inhaltlich nicht viel her. Und das so fatalerweise an einem Abend, der symbolisch steht für eine Zeit, in der doch etwas mehr Tiefgang, etwas mehr Aktualität gefordert ist, mehr Ambition, mit Kunst mehr zu erreichen als nur ein „Hach, so fühle ich mich auch manchmal“.